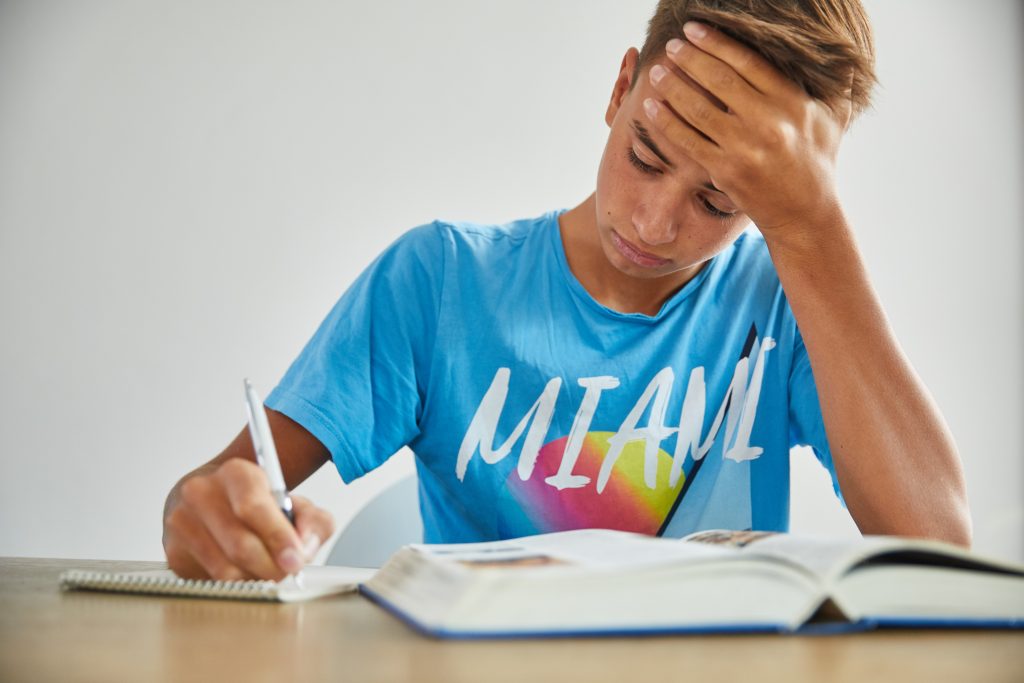
Sich monatelang nicht mit Freunden treffen und nicht in Vereinen, Sport- und Musikgruppen aktiv sein zu können, schlägt mehr als 80 Prozent der Schüler aller Altersstufen auf die Seele. - Foto: KKH/ (c) Christian Wyrwa, Diplom-Foto-Designer (FH), Burgwedeler Str. 91D
Corona stresst 77 Prozent der Schüler Umfrage: Angst vor beruflicher Zukunft und psychischen Störungen – KKH
Hannover, 03.06.2021 – Nicht nur Erwachsene, sondern auch Kinder und Jugendliche sind in ihrem Alltag Stress und hohen Belastungen ausgesetzt. Laut einer forsa-Umfrage im Auftrag der KKH Kaufmännische Krankenkasse steht ein Drittel der Sechs- bis 18-Jährigen dauerhaft unter Druck.
Die Corona-Krise hat die Situation noch einmal verschärft: 77 Prozent der rund 1.000 befragten Mütter und Väter sagen, dass die Pandemie ihr Kind belastet und zusätzlichen Stress auslöst. In der Gruppe der Eltern von Zehn- bis Zwölfjährigen haben dies sogar 83 Prozent beobachtet. Viele Eltern befürchten durch die Krise zudem langfristige negative Folgen für ihr Kind.
Einsamkeit und Langeweile größte Corona-Stressfaktoren
Sich monatelang nicht mit Freunden treffen und nicht in Vereinen, Sport- und Musikgruppen aktiv sein zu können, schlägt mehr als 80 Prozent der Schüler aller Altersstufen auf die Seele. Gut die Hälfte der Eltern gibt darüber hinaus an, dass sich ihr Kind durch das Lernen im Homeschooling gestresst fühlt. Unter den Zehn- bis Zwölfjährigen verspüren sogar rund zwei Drittel zusätzlichen Druck durch fehlenden Präsenzunterricht und digitales Lernen zu Hause, erst recht in Familien mit mehreren Kindern und wenig Platz für konzentriertes Arbeiten. „Wir kennen das alle. Wenn wir gestresst sind, dann geht es uns nicht gut.
Bei Kindern ist das nicht anders“, erläutert KKH-Psychologin Franziska Klemm. „Sie klagen dann zum Beispiel über Kopf- und Bauchschmerzen, können schlecht einschlafen oder reagieren schon auf Kleinigkeiten heftig und impulsiv.“
Zehn- bis Zwölfjährige leiden besonders
Ein größeres Problem für die Zehn- bis Zwölfjährigen als für die anderen Altersgruppen ist außerdem das Auf-sich-allein-gestellt-Sein, wenn Eltern auswärts arbeiten müssen, die Schulen geschlossen sind und keine Betreuung etwa durch Großeltern oder Nachbarn möglich ist. Dass sämtliche Veränderungen durch die Corona-Krise gerade Schüler in diesem Alter besonders mitnimmt, wundert Franziska Klemm nicht: „Mit elf, zwölf Jahren befinden sich die Kinder gerade in einer Umbruchsphase. Die Kindheit endet und die Pubertät beginnt. Das ist ohnehin schon eine schwierige Zeit, die viele Veränderungen mit sich bringt, sowohl körperlich als auch psychisch. Die Pandemie verstärkt einige dieser Herausforderungen noch und bringt zusätzliche, ganz neue Hürden mit sich.“
Zukunftsängste versus Entwicklungsstörungen
Die Älteren sind hingegen deutlich mehr von Zukunftsängsten geplagt als die Jüngeren: 36 Prozent der Schüler im Absolventenalter belastet die Sorge, durch die veränderten Lernbedingungen in der Krise den Anschluss in der Schule zu verlieren (im Vergleich zu 22 Prozent der Grundschüler). Dementsprechend befürchtet auch gut die Hälfte der Eltern von 16- bis 18-Jährigen, dass ihr Kind schlechtere berufliche Perspektiven durch längerfristige wirtschaftliche Probleme infolge der Corona-Krise haben könnte. Die Eltern der Sechs- bis Neunjährigen treibt hingegen vor allem die Sorge um, dass sich die Krise negativ auf die Persönlichkeitsentwicklung ihres Kindes auswirkt: Das sagt gut die Hälfte der befragten Mütter und Väter. Ein Viertel aller Eltern befürchtet außerdem, dass ihr Kind aufgrund der Corona-Krise psychische Erkrankungen wie Depressionen entwickeln könnte.
Dass diese Befürchtungen nicht ganz unbegründet sind, kann Professor Dr. Marcel Romanos vom Universitätsklinikum Würzburg bestätigen, denn in den vergangenen Wochen sind die Anmeldungen in den Kinder- und Jugendpsychiatrien in Deutschland wieder angestiegen. Hierzu tragen vor allem die Corona-bedingten Einschränkungen im Alltag bei, die zu einer zunehmenden Belastung geführt haben. So stehen etwa viele Eltern und Kinder unter erheblichem Druck, die Anforderungen im Homeoffice und Homeschooling zu bewältigen. „Familien, in denen es bereits vor der Pandemie psychische Erkrankungen gab, leiden besonders unter der Situation und klagen über Stress und Einsamkeit“, erläutert Romanos.
Aus seiner Sicht belegt die Umfrage, dass die mittlerweile lange Dauer der Pandemie auch den Kindern einiges abverlangt. Der Experte befürchtet allerdings, dass die eigentlichen Herausforderungen noch bevorstehen: „Wenn wir die Pandemie in den Griff bekommen haben, wird der Ruf laut werden, dass die Kinder das Versäumte so schnell wie möglich wieder aufholen sollen. Wenn wir dies undifferenziert und mit der ‚Brechstange‘ verfolgen, werden wir sehr schnell einen erheblichen Anstieg psychischer Störungen bei Kindern sehen.“
Schon vor Corona: Psychische Erkrankungen auf dem Vormarsch
Laut einer Datenanalyse der KKH haben bereits vor der Krise psychische Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen zugenommen, die sich aus emotionalem Stress und Konflikten entwickeln können. So sind die Fälle von Depressionen bei den Sechs- bis 18-jährigen KKH-Versicherten von 2009 auf 2019 um fast das Doppelte (rund 97 Prozent) angestiegen. Es folgen Anpassungsstörungen und depressive Reaktionen auf schwere Belastungen mit rund plus 72 Prozent, Angststörungen mit plus 45 Prozent, Schlafstörungen mit plus 29 Prozent und Essstörungen mit plus 13 Prozent. Immer häufiger stellen Ärzte außerdem schon im Schulalter die Diagnose Burnout. Auch da registriert die KKH im selben Zeitraum einen enormen Anstieg – bei den 13- bis 18-Jährigen sogar um mehr als das Doppelte. Das zeigt, dass schon vor der Krise immer mehr Schüler Schwierigkeiten bei der Lebensbewältigung hatten und ausgebrannt waren. Burnout ist keine eigenständige Krankheit, sondern gilt als Vorstufe zur Depression und wird in der Regel als Zusatzdiagnose im Zuge anderer, meist auch psychischer Erkrankungen gestellt.
2019 waren bundesweit rund 27.000 Sechs- bis 18-jährige KKH-Versicherte von einer oder mehrerer der genannten psychischen Leiden betroffen. Hochgerechnet auf ganz Deutschland sind das rund 1,3 Millionen Kinder und Jugendliche. Eine erste Datenauswertung für das erste Halbjahr 2020 deutet zudem darauf hin, dass die Zahlen auch in der Corona-Krise weiter steigen, denn bei allen genannten psychischen Erkrankungen liegt der Anteil der betroffenen Kinder und Jugendlichen in diesem Zeitraum bereits über dem Halbjahresdurchschnitt von 2019. Eine verlässliche Analyse ist aber erst möglich, wenn in einigen Monaten die Daten für das gesamte Jahr 2020 vorliegen.
Alte und neue Stressoren bei Kindern und Jugendlichen
Permanenter Leistungs- und Konkurrenzdruck in der Schule, Mobbing sowie gesellschaftlicher Druck durch Medien, Idole und Influencer: Das waren vor der Pandemie die Stressfaktoren, die Schülern am meisten auf die Seele schlugen (KKH-Umfrage von 2018). Zukunftsängste und Einsamkeit haben diese Faktoren in der Krise zwar zurückgedrängt, doch wenn der normale Schul- und Freizeitalltag wieder einkehrt, wird auch der Konkurrenzdruck beim Sport oder in der Schule wieder an Bedeutung gewinnen. Außerdem müssen Kinder und Jugendliche die Krise und ihre Folgen erst einmal verarbeiten.
Doch wie kann das am besten gelingen?
„Nach der Pandemie wird nicht sofort alles wie früher sein. Das dürfen Eltern auch von ihren Kindern nicht erwarten. Was während der Krise geholfen hat, ist daher auch nach der Krise besonders wichtig: Regelmäßige Gespräche über Ängste, Wünsche und Sorgen“, sagt KKH-Psychologin Franziska Klemm. „Auch positive Erlebnisse können helfen, den emotionalen Tank wieder aufzufüllen. Das können zum Beispiel Unternehmungen sein, die man gemeinsam plant und realisiert. Das war ja wegen der Corona-Einschränkungen in den vergangenen Monaten größtenteils nicht möglich.“ Den regelmäßigen Austausch in der Familie halten laut KKH-Umfrage auch 84 Prozent der Eltern für wichtig. Fast 90 Prozent der Mütter und Väter geben darüber hinaus an, dass Eltern ruhig bleiben und ein Vorbild sein sollten – und auch das gilt nicht nur für Krisensituationen.
Die KKH bietet zahlreiche Präventionsprogramme für Kinder und Jugendliche an und arbeitet mit dem Deutschen Zentrum für Präventionsforschung (DZPP) zusammen, um die psychosoziale Gesundheit von Kindern zu stärken und ein gesundes Aufwachsen zu fördern.
Erläuterungen zu Daten und Experten
Das Marktforschungsinstitut forsa hat im Auftrag der KKH 1.002 Eltern schulpflichtiger Kinder im Alter von sechs bis 18 Jahren im März/April 2021 bundesweit repräsentativ befragt. Basis für die Auswertung der psychischen Krankheiten nach ICD-10 sind anonymisierte Daten von bundesweit rund 200.000 KKH-versicherten Sechs- bis 18-Jährigen.
Professor Dr. Marcel Romanos ist u. a. Direktor der Klinik und Poliklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie der Universität Würzburg und Leiter des Deutschen Zentrums für Präventionsforschung (DZPP), mit dem die KKH zusammenarbeitet.
Franziska Klemm ist Psychologin und Mitarbeiterin im Fachbereich Prävention der KKH Kaufmännische Krankenkasse. Ihre Fachgebiete sind Stress, Sucht sowie psychosoziale Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen.
Die KKH Kaufmännische Krankenkasse ist eine der größten bundesweiten gesetzlichen Krankenkassen mit mehr als 1,6 Millionen Versicherten.
Nähere Informationen erhalten Sie unter kkh.de/unternehmen/kurzportraet.
Quelle: KKH Kaufmännische Krankenkasse
 EN
EN